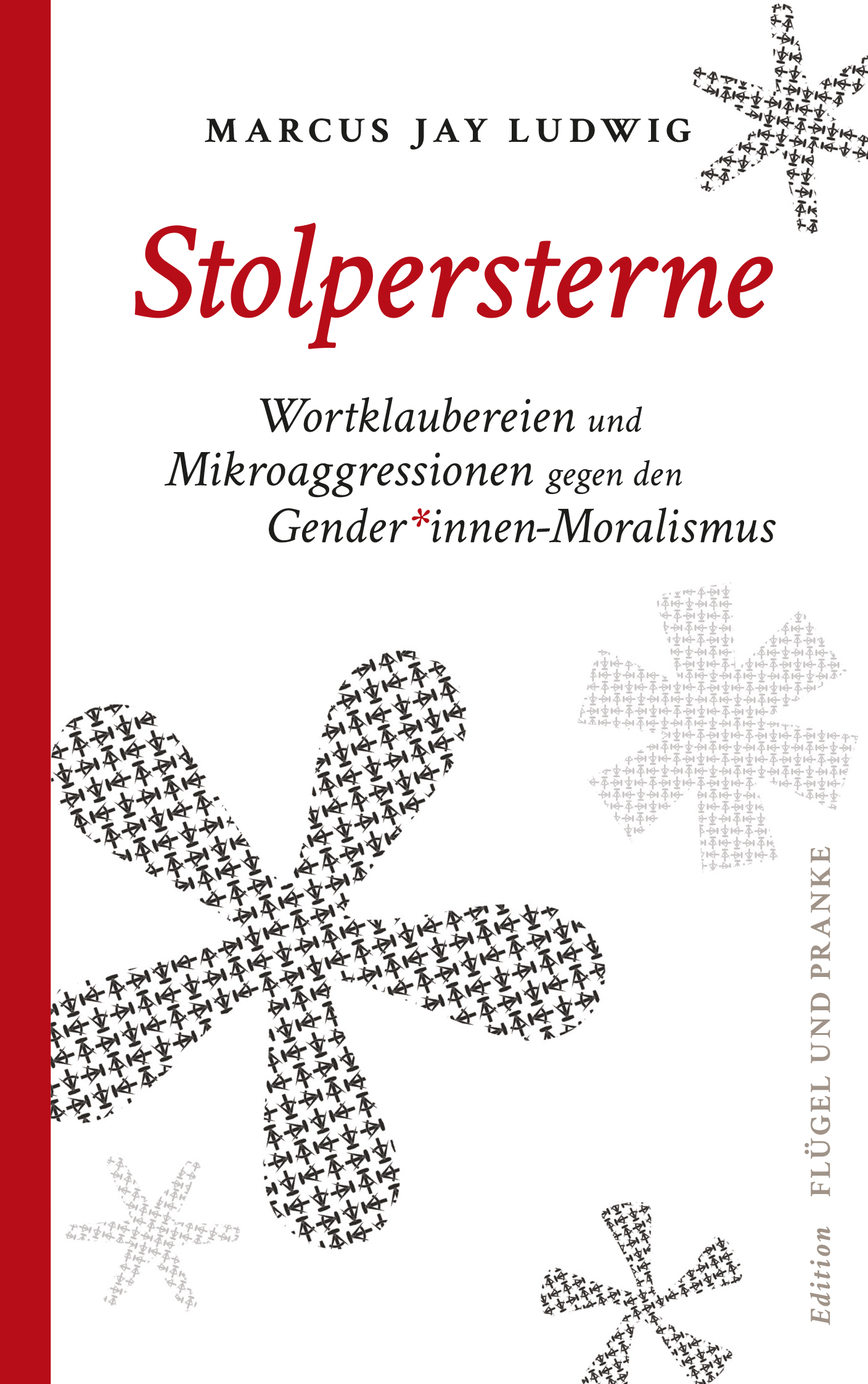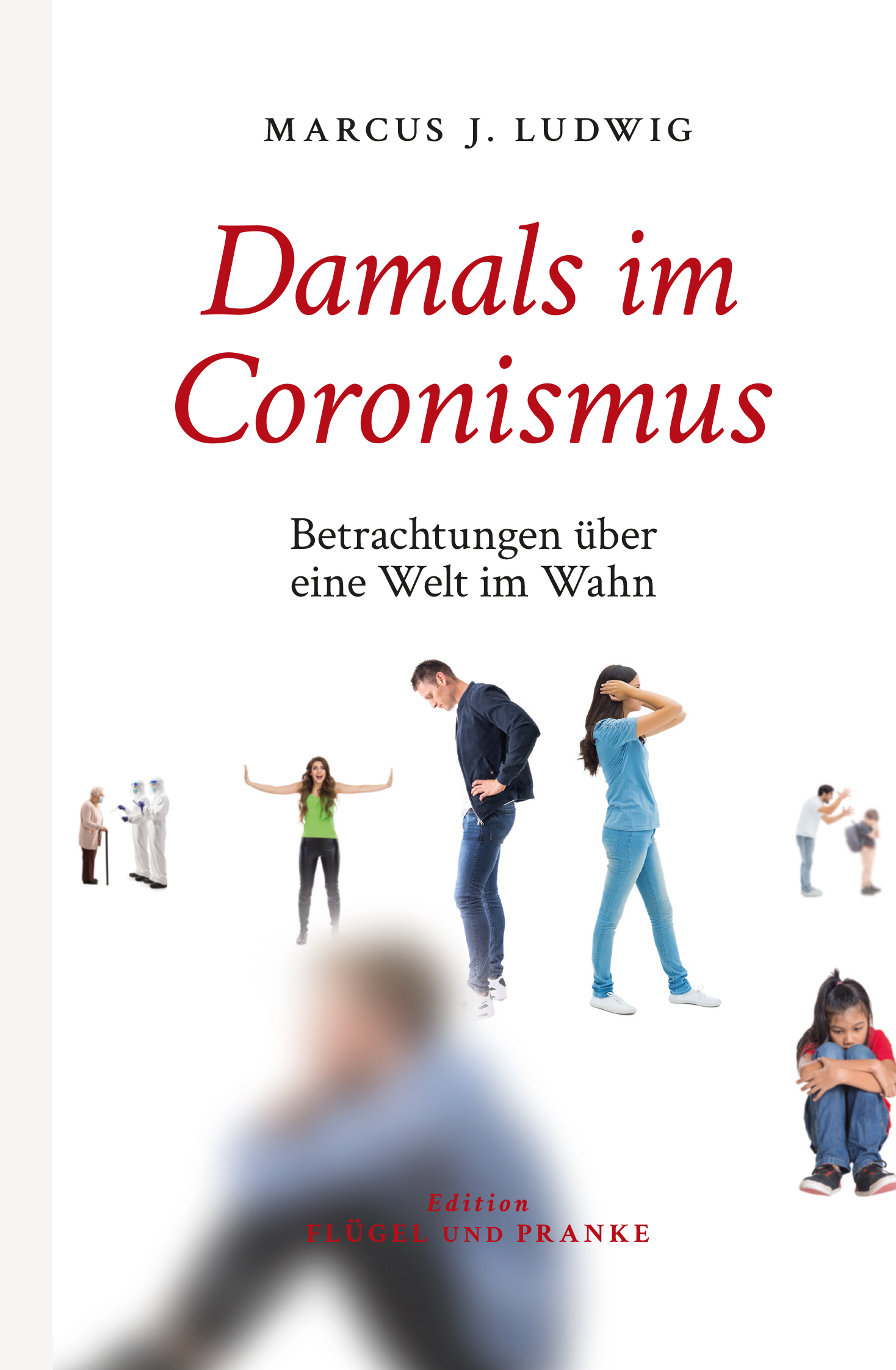Grobnotiertes Gemurmel beim Lesen von Thomas Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen“
– – –
Was alle immer haben! Oh Gott, herrje, uijui, o weh, das unmögliche Buch, das unsägliche Pamphlet! – Ich vermute, die Betrachtungen sind eines der ungelesensten bösen Bücher überhaupt. Wer auch sollte sich abseits von Thomas-Mann-Kolloquien groß für so was interessieren? Wenn man es mal täte – ich mein, 650 Seiten liest der durchschnittliche Trashmedienkonsument doch locker in einer Woche weg –, würde man feststellen: Gar nichts daran ist unsäglich. Alles ist höchst säglich.
Also, natürlich ist das Ganze höchst peinlich, aber nur in dem Sinne, wie halt alles direkte Reden und Stellung-Beziehen peinlich und kompromittierend ist. Man legt sich fest, man sagt aus vor der Wirklichkeit, und selbst wenn man es im Frageton tut, kann alles irgendwann gegen einen verwendet werden, auch noch in zehn oder hundert Jahren, noch die Urenkel werden womöglich Rede und Antwort stehen müssen. Solches betrachtend-polemische Reden ist etwas völlig anderes, als eine Romanfigur reden zu lassen. Man kann sie dieselben Sätze sagen lassen – es ist nie der Autor als echter, belangbarer Mensch, der da redet. In den Betrachtungen eines Unpolitischen redet der Mensch Thomas Mann. Es redet ein Künstler, der abwechselnd den Bürger und den Barbaren spielt. Und er redet brillant. Aber abgesehen davon, dass wer so redet, immer recht hat, gehört zu werden, steht das aparte Kriegsbuch nicht nur rhetorisch, sondern auch politisch, kulturkritisch-weltanschaulich, eben als Gedankenmonument und klärende Konfession mit vollem Recht in der Welt und im Werk Thomas Manns.
Bitte, was sagt er denn schon Schlimmes? Dass ihm diese eifernden Weltverbesserungsintellektuellen unfassbar auf den Sack gehen, das sagt er. Mit etwas anderen Worten freilich. Dass er, und somit der Deutsche – denn er verwechselt gern seine Probleme repräsentativ mit denen seiner Nation – nichts am Hut haben will mit Politik, mit Demokratie, mit westlichem Meliorismus und zivilisationsliterarischer Menschheitsbeglückung. Die Deutschen sind ein Kulturvolk, man gebe ihnen einen König, einen Kaiser, man lasse ihnen Schlösser und Throne und alte Ordnung und lasse sie ihr Kulturzeugs machen, damit immer mal wieder ein Goethe, ein Schopenhauer, ein Wagner, ein Nietzsche entstehe. Was gehen die Deutschen romanisch-rousseauistische und gar amerikanische Herdenideale an?
Kann man so fragen, kann man diskutieren, ohne sich unmöglich zu machen, mein ich. Und abgesehen von der mittlerweile wohl für immer erledigten Monarchiefrage ist es schon ziemlich interessant festzustellen, wie sehr unsere ganzen politisch-unpolitischen Probleme denen ähneln, die TM vor einem Jahrhundert betrachtete, es ist so ziemlich der gleiche Kulturkampf damals wie heute. Die Rollen sind anders besetzt, das Niveau ist ein (beschämend) anderes, aber die Typen und die Fronten sind relativ mühelos identifizierbar. Und man kann das Links-Rechts-Schema für so überholt und nichtssagend halten, wie man will – die Kämpfe sind damals wie heute Kämpfe zwischen Links und Rechts, zwischen linken und rechten Mentalitäten.
* * *
Eine Künstlerschrift nennt der Autor sein Produkt in der rückblickenden Vorrede. Das gilt es zu bedenken bei der Wahl des Empörungs- und Verurteilungs-Maßstabs. Der Künstler ist kein Ethiker im Sinne eines „Was sollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Wie uns entscheiden?“ Der Künstler – im Gegensatz zum Politiker – ist kein Entscheider. Natürlich hat er diesen Impuls, die Dinge von ihrem quälenden Schwebezustand zu befreien, Eindeutigkeiten zu schaffen, Ordnung und Lösung zu erzwingen. Aber er weiß, dass er das nicht darf. Je mehr Künstler er ist, desto mehr wird er dieser ethischen Aggressivität, die sich aus seinem Bürgertum, seinen bürgerlichen Leidenschaften speist, widerstehen. Seine – wohl etwas feige – Artistenlösung besteht darin, die Entschiedenheit als Figur, als eine Figur unter anderen, in die Unentschiedenheit hereinzuholen. In die Unentschiedenheit des vielstimmigen, vielfigurigen Romans. Dann erklingt wie Musik über den Worten jene epische Ironie, die in der Distanz, der Gleich-Gültigkeit im besten Sinne, das Ethische offenhält, um sich nicht von Alltäglichkeiten widerlegen zu lassen, nicht von klugen Lesern und Kritikern, sondern allein von der großen Besserwisserin: der Zeit. Etwas feige das Ganze, gewiss, aber solange diese Feigheit belohnt wird mit Ruhm und Ehre, werden sich stets mehr Leute zur Kunst als zur Politik berufen fühlen. – Was angesichts unserer Gegenwart zugegebenermaßen eine etwas kühne Prognose sein dürfte.
Jedenfalls: Wenn der Künstler dann doch mal den Bürger spielt, den Staatsbürger, der seinen „Zeitdienst“ leistet, indem er zweieinhalb Jahre lang Sätze zum Tag und zur Stunde niederlegt, gewissenhaft und zugleich mit der „Hemmungslosigkeit privat-brieflicher Mitteilung“, wenn er – einem Blogger nicht ganz unähnlich – ein wenig mitreden und miteifern zu müssen meint im Politischen, ja nun, mein Gott, dann lasse man ihn reden und seinen spielerisch-experimentellen Beitrag leisten. Eine Künstlerschrift ist kein Sachverständigengutachten.
* * *
Es redet hier ein Romantiker. Es redet ein den Wonnen des Irrationalismus nachtrauernder Sohn des träumerischen 19. Jahrhunderts gegen den Rationalismus des Zeitalters. Gegen den irgendwie ja notwendigen Rationalismus, er ahnt es. Und er weiß schon, indem er an seinem Rückzugsgefecht dichtet, dass er sich wird entschließen müssen zum Rationalismus, zur Republik, zu einer Art von gutmütig-gelassenem Sozialismus und sachlicher Vernunftpolitik. Er ist schließlich und vor allem eines: Realist. Der Realist weiß um sein grundromantisches Wesen, seine unverlierbare Märchensehnsucht nach allem Mütterlichen, Nächtlichen, Wollüstig-Tödlichen, und er weiß gleichzeitig, dass er sich dem Entschluss zum Erwachsenwerden, zur taghell entzauberten Weltwirklichkeit nicht ewig verweigern kann.
Der Realist muss sich entschließen, aber nicht entscheiden. Er darf sich nicht einmal entscheiden. Sofern er sein wirksamstes Machtmittel, seine Ironie, nicht aus der Hand geben will. Er muss Romantiker bleiben und Rationalist werden. Er muss beides in sich aushalten, er muss beides ganz sein, Es und Über-Ich, Mutter und Vater, Nacht und Tag, Meer und Gipfel, konservativ und progressiv, rechts und links. Der wahre Realist, der vollständige, freie, erwachsene Mensch, der „Ich“ sagen darf, ist ein vollständig Rechter und ein vollständig Linker. Gewiss ist er das eine mehr mit dem Herzen, und das andere mehr mit dem Kopf. Aber das heißt nicht, dass das eine nun DNA und Charakter wäre, und das andere nur Lippenbekenntnis.
Wahrscheinlich rühren die meisten unserer politisch-sozialpsychologischen Probleme aus diesem großen, grundtragischen Lebensmissverständnis, diesem voreiligen Imperativ: sich entscheiden zu müssen für eine von zwei Einseitigkeiten.
* * *
Ja, die Betrachtungen sind fortschrittsfeindlich. Ihr konservativer Widerstand richtet sich gegen den Fortschritt „von der Musik zur Demokratie“, von der Kultur zur Zivilisation. Noch scheint dem Widerständler dieser Fortschritt aufhaltbar, und er verlässt sich dabei auf die Stabilität des deutschen Charakters. Nie – so seine zum Totlachen optimistische Fehlprognose – nie, und lege er sich noch so viel „Demokratie“ zu, werde der deutsche Mensch das Leben nach Art des Boulevard-Moralisten handhaben, nie werde er unter dem Leben „die Gesellschaft“ verstehen. „Wir sind kein Gesellschaftsvolk.“ (S. 40) „Nur eine seelische Strukturveränderung, die völlige Umwandlung des Volkscharakters“ wäre vermögend, einen dahingehenden Umschwung herbeizuführen. (S. 41)
Nun, wenn wir uns hundert Jahre später so umschauen, dann ist die undenkbare Neubeseelung offenbar längst abgeschlossen, und der Umstand, dass die Feststellung unserer Verwandlung die allermeisten von uns einigermaßen ungerührt lässt, sagt eigentlich alles.
Es werde nichts übrigbleiben vom deutschen Wesen, befürchtet der Betrachter, „das Imperium der Zivilisation, die ‚Gesellschaft der Menschheit‘ könnte einen mehr romanischen oder mehr angelsächsischen Charakter tragen, – der deutsche Geist würde aufgehen und verschwinden darin, er wäre ausgetilgt, es gäbe ihn nicht mehr.“ (S. 43)
Wie wir heute wissen, war es dann die angelsächsische Zivilisation – und zwar in Gestalt ihres amerikanischen Ablegers –, die den deutschen Geist austilgen sollte. TM konnte damals noch nicht ahnen, wie recht diesem Geist die Auslöschung geschehen sollte, einem Geist, der sich als dermaßen fähig und freudig zu den geistlosesten, gefühl- und gesittungslosesten Untaten erweisen sollte. Aber es war nicht alles Strafe für die sündigen, weltbrüchigen zwölf Jahre. „Amerika“, das überseeische Neu-Europa, hatte sich ja schon viel früher angeschickt, den alten Heimatkontinent mental zu rekolonialisieren.
* * *
Man muss sich regelmäßig ins Bewusstsein rufen – und die Betrachtungen leisten dabei Beträchtliches –, was das „amerikanische Prinzip“ im Innersten mit uns angerichtet hat. Dabei geht es nicht um kulinarische Konsumverirrungen wie Coca-Cola und McDonalds, es geht um die Einstellung zum Leben selbst, um die ganze charakterliche Grundausrichtung. Das „amerikanische Prinzip“ ist die wesensmäßige Orientierung auf den Erfolg hin. Der Amerikaner ist Unternehmer seines eigenen Lebens. Er will „es schaffen“, „es zu etwas bringen“. „If you can make it there you can make it anywhere“ – so lautet das karrieristische Credo, der frenetische Refrain des „Make-it“-Individualismus. Was genau „it“ ist, ob du „es“ als Showstar oder als Salesman „schaffst“, spielt keine große Rolle, Hauptsache es macht deine Existenz zu einer Erfolgsstory. Das maximal vorstellbare Sozialgebilde dieses Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Typus ist die Gesellschaft, die Society. Gemeinschaft dagegen, Community, oder auch nur das, was man im allgemeinste Sinne als Genossenschaft bezeichnen könnte, ist unter der Herrschaft solcher Triebstrukturen kein realistischer, nicht mal ein wünschenswerter Zustand. Mehr als eine additive Ansammlung von zweckmäßig sozialisierten Einzelnen ist hier von vornherein kaum zu erwarten. Diese rein funktionale Daseinsform mit ihren seelischen Dispositionen, ihren Wünschen, Sehnsüchten, Träumen, Erwartungen ist uns Europäern – vor allem uns charaktergewaschenen, re-educateten Deutschen – dermaßen zur Normalität geworden, dass jeder alternative Entwurf uns mittlerweile völlig abwegig erscheinen muss. Ja, was soll denn bitte verkehrt sein am Individualismus, jenem psychosozialen modus vivendi, in dem man sich um sein eigenes Stück Land, seinen persönlichen Lebenserfolg, sein privates Wohlergehen, um seine Daseinsshow und sein Seelenheil sorgt? Sollen wir etwa stattdessen einen krassen Kollektivismus anstreben, einen Termitenbau, in dem der Einzelne nur Teil einer emsigen Masse ist, die unablässig an der Konstruktion und Instandhaltung des Staates, des großen Selbstzwecks, arbeitet?
Wer so denkt, hat vergessen, dass es einmal etwas dazwischen gab, zwischen Amerika und Asien (wie es übrigens auch völkerpsychologisch etwas zwischen Extroversion und Introversion gab, zwischen Exhibitionismus und Kontrolliertheit, zwischen westlicher Showkultur und östlicher Schamkultur), es gab zwischen dem Selfmademan und der Verameisung etwas spezifisch Europäisches, ja sogar etwas spezifisch Deutsches, meinetwegen auch Schwedisches, Niederländisches oder Schweizerisches: die Bürgerschaft. Die Bürgerschaft als jene mittlere Erscheinungsform der politischen Großgruppe, die weder eine Zweckgesellschaft aus Individualisten, Unternehmern und Konsumenten ist, noch ein gesichtsloses Massenkollektiv, in dem Glück und Eigen-Sinn des Einzelnen dem System geopfert werden, sondern eine geordnete Gemeinschaft freier Menschen, die nach Fähigkeiten und Kräften ihren jeweiligen Beitrag zum Gelingen des Ganzen leisten, zu einem Gemeinwesen, dem sie sich aus eigenem Antrieb verpflichtet fühlen, weil sie es als ihren natürlichen Lebensraum lieben gelernt haben und als ihr kultürliches Habitat erkannt haben, welches es zu pflegen, zu bewahren und stetig zu verbessern gilt.
Diese europäische Bürgerlichkeit geht – entgegen dem Tenor auf Cocktailpartys pensionierter Lateinlehrer – nicht erst unter, seit GIs die deutsche Jugend mit Cola, Kaugummi und Jazz anfixten, seit die Siegermächte – Amerika voran – die Deutschen und mit ihnen „das Deutsche“ ein für alle Mal unschädlich machten, so weit es eben ging (und es ging sehr weit). Amerika zeichnete sich als problematische Verheißung, als chromglitzernder Zivilisations-Westen und strahlend lachende Antikultur schon seit dem ersten Weltkrieg ab. Stefan George wusste manches Lied darüber zu singen. Er verschmähte sogar demonstrativ den Genuss von transatlantischem Obst, insbesondere die Ananas war ihm – rein ideologisch – zuwider.
Aber die deutschen und geheim-deutschen Intellektuellen übersahen das Wesentliche, wenn sie Engländer und Amerikaner als „Krämerseelen“ und „Händlervolk“ verspotteten. Die degenerative Kraft lag nicht im Handel, sondern im Konsum. Das Volk heldischer Dichter und Denker wurde am Ende nicht von merkantilistischer Wollust überwältigt, sondern erlag den Verführungen des Konsumismus. Die Masse will ja nicht Verkäufer sein, sondern Verbraucher. Und sie unterwirft ihr Leben leichten Herzens dem, der sie mit günstigen Leckereien versorgt. Nicht so gern dem, der strenge Zucht und Griechentum predigt.
Noch die deutsche Einheit ist unverkennbar eine Frucht des Amerikanismus: ein Systemsturz, ein Durchbruch im Sog des kraftprotzend-weltmännischen Gewinner-Lifestyles. Die Vehemenz, die Entschiedenheit der Revolution speiste sich sicherlich nicht nur aus dem Verlangen nach Bürgerrechten und geistiger Kost. Südfrüchte und Cheeseburger spielten sub specie stimulationis womöglich, kann sein, wer weiß, eine größere Rolle als die theoriegesättigten bunten Taschenbücher der Edition Suhrkamp.
Ist aber nur so mein nachträglicher Eindruck …
* * *
Der Rechte ist im Grunde der Unpolitische. Er ist nur auf Zeit politisch, nur gezwungenermaßen, nur so lange, bis er den Anlass für seine Politisierung wieder beseitigt hat. Politik ist eigentlich immer Sache der Linken. Was ist Politik denn anderes als Sozialkonstruktivismus?
Politik, diese Zumutung, gegen die sich der trotzig unpolitische Thomas Mann so vehement wehren musste, um sich schon bald für die Republik gewinnen und am Ende in den Kampf gegen Hitler zwingen zu lassen – einen Kampf, welcher allerdings kaum noch ein politischer, vielmehr doch ein moralischer Kampf war –, Politik, in der Tat, ist das Ungeistige, Unkünstlerische schlechthin. Vereindeutigung der Welt, ironielose Parteinahme, Ende aller Poesie. Alle Musik wird schal, alle Nacht vom Kunstlicht entweiht, wenn die Zeit die Krise kriegt, alle Romantik wird lächerlich, wenn der Mensch Haltung annehmen muss, sich auf eine Seite schlagen muss, das Zusammenleben regeln muss, herrschen oder opponieren muss.
Der Mensch, der Musik, Natur, Geist, Erkenntnis liebt, kennt nichts Widerwärtigeres als die Politik. – Der Mensch? Oder nur der Deutsche? – Man versteht noch, wenn man seine Ohren lange genug am Klang des 19. Jahrhunderts geschult hat, warum die Politik einmal das Undeutsche par excellence war. Um das empfinden zu können, muss man sich freilich die Deutschen von heute gründlich aus dem Kopf schlagen. Was aber irgendwie auch nicht sonderlich schwierig ist, wenn man einmal begriffen hat, dass es die Deutschen gar nicht mehr gibt. Es wird immer deutlicher, dass das kein geistreicher Verblüffungs-Gag, sondern die trostlose Wahrheit ist: Es gibt sie nicht mehr, sie sind ausgestorben. Es gibt hier und da noch „das Deutsche“, aber es gibt kein Volk mehr als Trägersubstrat einer geistigen Lebensform, einer Kultur, einer bestimmten sittlich-lebensstilistischen Konkretisierung des Menschlichen. Es gibt Nachfahren der Deutschen, so wie es Nachfahren der alten Römer und Griechen gibt. Thomas Mann schon empfand seine Existenz als historisch, als überständig und einsam ragend, hinüber in die Epoche der betriebsam-närrischen Massenmenschheit, die mit all ihren Freiheiten nichts anzufangen weiß. Und mit ihm und seiner Generation ist in der Tat das Deutsche weitgehend zu einer Sache der Gesamtausgaben, der Archive und Museen geworden.
* * *
Die TM-Gesamtausgabe, die Große kommentierte Frankfurter Ausgabe (GKFA), zählt zum Schönsten, was ich kenne in der Welt geistiger Gegenständlichkeit. Heilsam-feierliche Bibliomagie! Die blauen Leinenbände mit den schlicht beigen, prosaisch ungestrichenen Papierumschlägen sind Berührungsreliquien, die den Bedürftigen gegen jede Zeitverwirrung zu beruhigen vermögen, hier ist Heimat, hier ist das sichere Reich des glanzvoll Durchdachten und lebensgültig Verdichteten. Ich weiß gewiss, dass die Welt dieser Wälzer, dass dieser erzählte, ergrübelte, einer kargen Realität abgetrotzte Himmel mir für den Rest meines Lebens nicht mehr abhandenkommen kann. Thomas Mann bleibt. Er bleibt mir in diesen kostbar-gediegenen (und teuer bezahlten!) Regalmetern, die – wenn sie irgendwann mal vollständig sein sollten – wohl mehr Gewicht auf die Waage bringen werden als ich. – Ich merke, wie Nietzsche mir zuweilen abhandenkommt, wie ich älter werde als er, wie er mir stellenweise, trotz seiner unendlichen Überlegenheit, irgendwie jugendlich wird, bei aller Heiligkeit beinahe vorlaut. Ich merke, wie Fontane mich zuweilen langweilt, wie Wagner mich nervt, wie Freud Staub und Rost ansetzt, wie Hesse mir mitunter doch zu spirituell und Zweig etwas zu prätentiös und feuilletonistisch daherkommt – nichts davon bei TM, meiner ersten großen Dichterliebe.
Aber diese Liebe kommt mich, ich sagte es, wahrlich teuer zu stehen, denn die Preise sind echt der Hammer! Vor allem neuerdings, da der Fischer Verlag, wie es scheint, zwischendurch mal einen Satz neuer Taschenrechner angeschafft hat. Kürzlich wollte ich mir nach langem Zögern endlich die Josephs-Tetralogie genehmigen, musste jedoch mit zitternder Hand den Kaufvorgang abbrechen. Offenbar haben Fischers Finanz-Ilsen alles noch mal durchkalkuliert, und jetzt kosten die beiden Josephs-Doppelbände statt 85 und 96 Euro (2018) plötzlich 195 und 248 Euro! Ich bin der literarischen Welt als strikter Gegner eines ausufernden Ausrufezeichengebrauchs bekannt, aber hier muss ich denn doch mal ein bisschen lauter werden: 443 Euro!!! Bei Erscheinen noch 181 Euro!!! Und jetzt 262 Euro mehr!?!?! Das ist eine Verteuerung um … total viele Prozent!!! Und für solche Unsummen – das macht mich am allermeisten fertig – kriegt man dann noch nicht mal eine Übersetzung der französischsprachigen Stellen! Also, jetzt nicht beim Joseph, da wird, soweit ich mich erinnere, eh nicht allzu viel Französisch parliert, aber in den Betrachtungen andauernd. Und Kurzkes Kommentar schweigt mit der noblen Arroganz des mitteleuropäischen Hochbildungsbürgers, der sich gar nicht vorstellen kann, dass es Thomas-Mann-Leser geben könnte, die zu Gymnasialzeiten, lange bevor sie mit TMs Werken richtig in Kontakt kamen, die unlogisch-elegante Nuschelsprache unserer westlichen Nachbarn bei erster Gelegenheit bereits abgewählt hatten, und sich einfach nicht dazu durchringen konnten, nur für das Verständnis einzelner Buchstellen später noch einen mehrjährigen Französisch-Nachholkurs an der VHS zu besuchen.
Es gibt, Herr Professor, solche Leser, und die hätten gerne fremdsprachige Textstellen übersetzt, vor allem, wenn sie für den Kommentarband einen verdammten Koffer voll Geld über den Tresen geschoben haben!!!
Ansonsten allerdings ist Kurzkes Kommentar in jeder Hinsicht vorzüglich, wie nicht anders zu erwarten bei diesem, neben Hans-Rudolf Vaget, wohl besten Kenner Thomas Manns. Wobei es gar nicht so sehr um Kennerschaft geht, sondern um … wie soll ich sagen … Intimität? Man merkt ja sofort, ob jemand mit angelesenem Germanistenwissen prunkt, oder ob eine lebenslängliche liebevolle Beschäftigung mit einem verwandten und bewunderten Geist ihn befähigt, seinen Gegenstand aus nächster Nähe, zuweilen sogar aus der Innenperspektive zu erläutern. Wenn jemand in der Psyche des Zauberers Bescheid weiß, dann Hermann Kurzke. Und er versteht es, dem Leser seine Einsichten so darzubieten, dass man mit dem eigenen Vor- und Halbwissen leicht andocken kann an alle höheren Arkana, sich herzlich gern und widerstandslos unterweisen, aufklären, einweihen lässt.
Wer keine Lust und keine Lebenszeit übrighat, sich durch zehntausende Seiten Thomas-Mann-Sekundär-Schrott zu quälen, der braucht – außer der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe selbst – eigentlich nur zwei weitere Bücher: Kurzkes Biographie Thomas Mann – Das Leben als Kunstwerk und sein ungemein erhellendes „Arbeitsbuch“ Thomas Mann – Epoche, Werk, Wirkung.
Ich träume von einem Leben als unpolitischer Thomas-Mann-Fetischist, in dem ich nichts anderes zu tun habe, als in ewiger Endlosschleife diese beiden Bücher und die 38 Bände der GKFA zu lesen. Essen und Trinken tät ich vielleicht noch, und ein paar anderen Lustbarkeiten mich hingeben, die mich möglichst weit von meiner Gegenwart, von dieser Nachwelt entfremden, in die ein seltsamer Schicksalsirrtum mich verschlagen hat.
Fortsetzung folgt …
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2022
Alle Rechte vorbehalten